»Es ist ein Glückseindruck – pur und unverfälscht: Das Gefühl, wenn ein Stück Schokolade langsam auf der Zunge zergeht, wenn unbeschreibliche Erleichterung auf ein herbeigesehntes kühles Getränk sich mit den Eindrücken der Geschmacksrezeptoren in unserem Mund vermischt, wenn einen die ungehemmte Freude nach einem erfolgreichen Sportereignis durchflutet. Dafür sorgt das neuronale Belohnungssystem in unserem Kopf – das NBS gibt den Takt vor und motiviert uns zum Handeln.
Hunger und Durst und Freude sind wichtige Grundbedürfnisse, die uns via Kopfsteuerung antreiben. Werden sie gestillt, belohnt uns das Gehirn mit Glücksgefühlen. Doch geht das Funktionsprinzip weit darüber hinaus: Menschen sehnen sich nach Nähe, Liebe und aufregenden Erlebnissen. Der Adrenalinkick einer Kletterpartie oder einer Achterbahnfahrt, der Reiz extremer Herausforderungen oder das Streben nach großen Zielen wie Besitz, Familie oder Urlaub – all das geschieht in der Hoffnung auf das große Glück, wobei unser Handeln immer von einem unsichtbaren Motivator gesteuert wird: dem NBS. Wobei bereits die Aussicht auf eine Belohnung (Erfolg, Schokolade, Sex) unser Verlangen weckt und uns bringt in Bewegung bringt. Spüren wir Freude oder Glück, flutet das Gehirn unseren Geist ebenso wie den Körper mit Botenstoffen – das sorgt für Wohlbefinden und Antrieb. Doch exakt die gleiche Kraft, die uns antreibt, kann uns auch zum Verhängnis werden: Sie kann süchtig machen und dadurch einen Menschen ins Unglück führen.
Das NBS wurde bereits Mitte der 1950er Jahre entdeckt und das durch reinen Zufall. US-Forscher um James OLDS (1922 – 1976) vom California Institute of Technology hatten eigentlich vor, etwas völlig anderes zu erforschen. Ihr Projekt war: „Wie lernen Ratten?“ Dafür pflanzten sie den Tieren Elektroden in den Kopf, um gezielt bestimmte Gehirnareale mit leichten elektrischen Impulsen zu stimulieren. Und hierbei unterlief einem von ihnen ein Fehler mit weitreichenden Folgen: Bei einer Ratte landete die Elektrode versehentlich in einem anderen Hirnbereich als geplant. Die Überraschung war groß, dass das Tier immer wieder genau an die Stelle zurückkehrte, an der es die elektrische Stimulation erhalten hatte. Sogar am nächsten Tag suchte es diesen Ort erneut auf, als würde es sich nach weiteren Stromstößen sehnen.
Um der Sache auf den Grund zu gehen, setzten Olds und seine Kollegen ihre Versuchstiere in eine sogenannte Skinner-Box – dies ist ein spezieller Käfig, in dem sich die Ratten durch das Drücken eines Hebels selbst Stromstöße versetzen konnten. Und das Ergebnis war erschreckend eindrucksvoll, denn bereits nach nur wenigen Minuten hatten die Tiere gelernt, sich selbst zu stimulieren. Fortan drückten sie alle fünf Sekunden den Hebel und die immer wieder, bis zur völligen Erschöpfung. Dass man ihnen leckeres Futter und Wasser vorsetzte, war ihnen völlig egal; die armen Tiere konzentrierten sich nur noch auf das „Glückshebelspiel“, bis sie schließlich zusammenbrachen. Olds fasste es später so zusammen: „Alleingelassen mit dem Apparat, stimulierten die Ratten nach zwei bis fünf Minuten Lernzeit das eigene Gehirn regelmäßig etwa alle fünf Sekunden.“ Diese bahnbrechende Entdeckung zeigte zum ersten Mal, was ein neuronale Belohnungssystem ist, wie mächtig es sein kann und wie sehr es unser Verhalten, das dem der Ratten ähnelt, triggert.
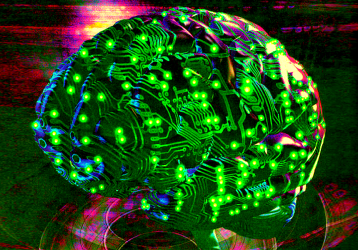
In den Jahren nach ihrer Entdeckung kartierten Forschende das Belohnungssystem des Gehirns mithilfe zahlreicher Experimente und fanden heraus, dass es aus einem Netzwerk verschiedener Hirnareale und Nervenverbindungen besteht. Der zentrale Akteur in diesem System ist Dopamin, oft als „Glücksbotenstoff“ bezeichnet, wobei dieser mittelbar dafür sorgt, dass wir Freude empfinden und uns motiviert, bestimmte Handlungen immer wieder auszuführen. Mittelbar deshalb, da Neuowissenschaftler lange Zeit davon ausgingen, dass Dopamin direkt für unser Lustempfinden verantwortlich ist. Sie glaubten, dass Tiere und Menschen nach bestimmten Handlungen streben, weil Dopamin ein Hochgefühl auslöse, das sie immer wieder erleben möchten. Doch 1996 stellten der Neurologe Kent BERRIDGE und andere US-Forschende diese Theorie infrage. In Experimenten mit Laborratten zerstörten sie gezielt Nervenverbindungen in deren Gehirn, die den Dopaminfluss regulieren.
Die Folge war, dass die Ratten aufhörten zu fressen, wenn die Dopaminkonzentration in diesen Arealen drastisch sank. Doch ein Detail war bemerkenswert: Berridge legte den Tieren Futter direkt auf die Zunge – und sie fraßen es ganz normal. Die Ratten mochten die Nahrung also weiterhin, hatten aber im Grunde kein Verlangen mehr danach. Ihm wurde klar: Dopamin erzeugt nicht unbedingt Lust, sondern vor allem Motivation. Ohne Dopamin fehle schlicht der Antrieb, aktiv nach Nahrung zu suchen.* Weitere Tests bestätigten diese Erkenntnis: Bei gesunden Ratten führten gezielte Reizungen zu starkem Fressverlangen – allerdings ohne zusätzlichen Lustgewinn. Das zeigte: Dopamin verstärkt das Wollen, nicht das Mögen. Hierzu muss man wissen: Dieses Prinzip kannte man bereits von klassischen Suchterkrankungen, denn viele Drogen beeinflussen die Dopaminausschüttung, was ein unkontrollierbares Verlangen erzeugt, auch ohne echte Befriedigung.
Fazit: Lange Zeit glaubte die Hirnforschung, dass Dopamin für das Hochgefühl verantwortlich ist, das wir empfinden, wenn wir eine ersehnte Belohnung erhalten. Doch neuere Erkenntnisse zeigen deutlich, dass diese Rolle eher den körpereigenen Opiaten, den Endorphinen, sowie Botenstoffen wie Oxytocin zukommt. Dopamin hingegen ist aus heutiger Sicht eher ein Neurotransmitter für die Belohnungserwartung – also der Mechanismus, der uns antreibt, nach einer Befriedigung zu streben. Ein einfaches Beispiel: Wenn sich jemand anderes ein Stück Schokolade langsam auf der Zunge zergehen lässt, kann natürlich nicht die fremdgenossene Schokolade den Dopamin-Kick in unserem Kopf auslösen, sondern es ist der Anblick ihres Genusses. Das Gehirn erwartet nun umgehend eine ähnliche Befriedigung unseres eigenen Verlangens und genau dieser Moment der Erwartung aktiviert das sog. mesocortikolimbische System, das man (profaner ausgedrückt) „Das neuronale Belohnungssystem in unserem Kopf“ nennt. Es wird immer dann aktiv, wenn wir eine Belohnung erwarten – nicht erst, wenn wir sie tatsächlich bekommen. Das zeigt: Dopamin treibt uns an, ist der Neurotransmitter der Anreizerwartung, der uns jedoch nicht zwangsläufig glücklich macht.«
[Ein Text von Rainer W. Sauer aus dem Jahre 2022]
* = siehe die Studie „The Functional Neuroanatomy of Pleasure and Happiness“ von Kringelbach / Berridge, Oxford University USA, 2010.

Schreibe einen Kommentar